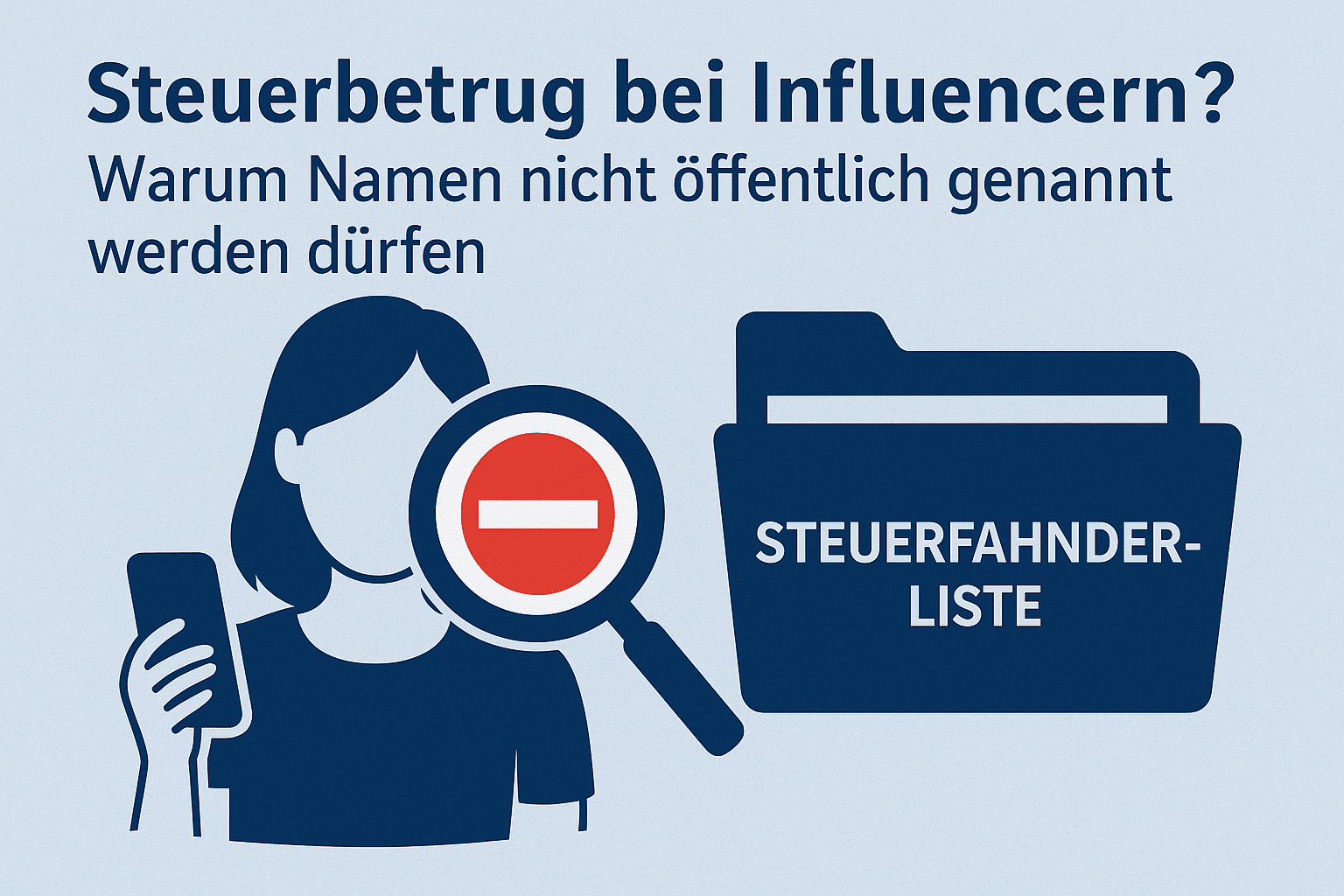Die Meldung schlug in der vergangenen Woche ein: „Influencer sollen massiv steuern hinterzogen haben“, titelte etwa die Tagesschau (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/digitales/steuerhinterziehung-influencer-finanzkriminalitaet-100.html ). Die BILD-Zeitung schrieb „Deutsche Influencer – Ihr Geprotze brachte die Steuerfahnder auf die Spur.“
Laut verschiedener Medien existiere eine „Steuerfahnder-Liste von Influencern“, auf der zahlreiche prominente Namen der Szene zu finden sind. Die BILD-Zeitung spekuliert bereits über konkrete Namen, erste Influencer melden sich in den Medien gar zu Wort und geben Statements zu den Vorwürfen ab.
Warum dies keine gute Idee ist – und warum die Medien die Namen der Personen auf der Liste in der Regel nicht nennen dürften, erklärt dieser Beitrag.
Exkurs: Steuerpflicht für Influencer – Was gilt rechtlich?
Wer ist steuerpflichtig?
Influencerinnen und Influencer, die regelmäßig Einnahmen durch Kooperationen, Werbung, Produktplatzierungen, Affiliate-Links oder durch eigene digitale Produkte (z. B. E-Books, Presets, Online-Kurse) erzielen, gelten aus steuerlicher Sicht in der Regel als selbstständige Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) sowie § 15 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG).
Je nach Art und Umfang der Tätigkeit kann es sich dabei um eine freiberufliche (§ 18 EStG) oder – deutlich häufiger – um eine gewerbliche Tätigkeit (§ 15 Abs. 2 EStG) handeln. Maßgeblich ist, ob die Tätigkeit auf Dauer angelegt, selbstständig und mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt.
Damit unterliegen Influencer denselben steuerlichen Pflichten wie andere Unternehmer auch. Dazu zählen insbesondere:
- Einkommensteuer (§§ 2 ff. EStG): Auf alle erzielten Einnahmen – abzüglich betrieblicher Ausgaben – ist Einkommensteuer zu zahlen.
- Gewerbesteuer (§§ 2 ff. GewStG): Bei Überschreiten des Freibetrags von 24.500 € jährlich greift die Gewerbesteuerpflicht.
- Umsatzsteuer (§§ 1, 19 UStG): Grundsätzlich sind Influencer umsatzsteuerpflichtig. Die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG kann greifen, wenn der Jahresumsatz im Vorjahr 22.000 € und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigt.
- Pflichten zur Buchführung oder Einnahmenüberschussrechnung (§§ 140–147 AO, § 4 Abs. 3 EStG): Auch bei kleinen Unternehmen sind Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar zu dokumentieren.
Typische Fehlerquellen bei Influencern
Gerade bei jungen Content Creators oder schnell gewachsenen Accounts fehlt es häufig an steuerlicher Beratung und Bewusstsein für die rechtlichen Pflichten. Das führt zu klassischen Fehlern wie:
- Nichtangabe von Sachleistungen (z. B. Produkte, Reisen, Dienstleistungen), obwohl diese als geldwerter Vorteil steuerlich zu erfassen sind – siehe § 8 EStG und § 3 Abs. 9 UStG.
- Versäumte steuerliche Anmeldung beim Finanzamt, insbesondere die nicht rechtzeitige Abgabe des „Fragebogens zur steuerlichen Erfassung“ (§ 138 AO).
- Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben (§ 146 AO), oft wegen unklarer Trennung zwischen privater und geschäftlicher Nutzung.
- Falsche oder unterlassene Umsatzsteuer-Abführung, etwa weil Kooperationsvergütungen aus dem Ausland kommen oder Rechnungen fehlerhaft ausgestellt werden (§§ 14, 14a UStG).
Strafrechtliches Risiko: Steuerfahndung trotz Unwissenheit
Auch wenn Verstöße häufig aus Unkenntnis geschehen, kann dies schwerwiegende steuerstrafrechtliche Folgen haben. Steuerhinterziehung nach § 370 Abgabenordnung (AO) liegt bereits dann vor, wenn Steuern verkürzt oder zu niedrig angegeben werden – selbst wenn dies fahrlässig geschieht (§ 378 AO: Leichtfertige Steuerverkürzung).
In solchen Fällen kann die Steuerfahndung (Steufa) tätig werden, etwa bei plötzlichen Einnahmesprüngen, verdächtigen Transaktionen oder auf Grundlage von Hinweisen – auch aus der Öffentlichkeit oder von Geschäftspartnern.
Presserechtlicher Rahmen: Verdachtsberichterstattung
Wird gegen einen Influencer wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt, gelten in Deutschland die sog. Grundsätze der Verdachtsberichterstattung. Das deutsche Recht findet auch für im Ausland (etwa in Dubai) ansässige Influencer Anwendung, wenn die Berichterstattung bestimmungsgemäß auch in Deutschland gelesen wird. Dies ist bei deutschen Influencern, die auch ihren Account auf Deutsch bespielen, in der Regel der Fall.
Die sogenannte Verdachtsberichterstattung bezieht sich auf die mediale Berichterstattung über Personen, gegen die ein strafrechtlicher Verdacht besteht – etwa im Zusammenhang mit einem Steuerstrafverfahren (§ 370 AO).
Eine solche Berichterstattung ist nur unter engen Voraussetzungen zulässig, da sie einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen darstellt (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG).
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (GRUR 2023, 1391 Rn. 25 m.w.N.) sind dies die Voraussetzungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung:
„Erforderlich ist jedenfalls ein Mindestbestand an Beweistatsachen, die für den Wahrheitsgehalt der Information sprechen und ihr damit erst „Öffentlichkeitswert“ verleihen. Die Darstellung darf ferner keine Vorverurteilung des Betroffenen enthalten; sie darf also nicht durch präjudizierende Darstellung den unzutreffenden Eindruck erwecken, der Betroffene sei der ihm vorgeworfenen Handlung bereits überführt. Auch ist vor der Veröffentlichung regelmäßig eine Stellungnahme des Betroffenen einzuholen. Schließlich muss es sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht handeln, dessen Mitteilung durch ein Informationsbedürfnis der Allgemeinheit gerechtfertigt ist.“
Diese Voraussetzungen müssen kumulativ eingehalten werden. Da eine Verdachtsberichterstattung zudem nur ausnahmsweise bei Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes (§ 193 StGB) zulässig ist, sind strenge Maßstäbe an die Einhaltung der Zulässigkeitsvoraussetzungen anzulegen.
Die bloße Einleitung eines Ermittlungsverfahrens reicht nach der Rechtsprechung zudem nicht aus, um hierüber in erkennbar machender Weise zu berichten, vgl. BGH NJW-RR 2017, 3 Rn. 26, m.w.N.:
„Die bloße Tatsache der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens als solche genügt jedenfalls nicht für die Annahme des Vorliegens eines Mindestbestands an Beweistatsachen. Die Staatsanwaltschaft hat schon beim Vorliegen einesAnfangsverdachts Ermittlungen aufzunehmen (vgl. § 152 Abs. 2, § 160 Abs.StPO, § 160 Absatz 1 StPO). Dafür ist bereits ausreichend, dass aufgrund zureichendertatsächlicher Anhaltspunkte nach kriminalistischer Erfahrung die bloße Möglichkeit einerverfolgbaren Straftat gegeben ist.“
Dies wird insbesondere damit begründet, dass Ermittlungen bereits bei Vorliegen eines Anfangsverdachts aufzunehmen sind und diese Schwelle äußerst gering ist; es genügen also schon entfernte Verdachtsgründe. Diese entfernten Verdachtsgründe können jedoch keinen äußerungsrechtlich relevanten Mindestbestand an Beweistatsachen für einen derart schwerwiegenden Vorwurf rechtfertigen.
Es entspricht allgemeiner Rechtsprechung, dass im Stadium eines Ermittlungsverfahrens regelmäßig das Anonymitätsinteresse des Betroffenen überwiegt.
Fazit: Influencer dürfen nicht namentlich genannt werden
Eine namentliche Nennung von Influencern, die auf einer möglichen Steuerfahnder-Liste stehen, ist in der Regel unzulässig. Mögliche strafrechtliche Verfahren befinden sich in einem Anfangsstadium, sodass es an einem Mindestbestand an Beweistatsachen für eine identifizierbarmachende Berichterstattung bereits fehlen dürfte.
Influencer, die von einer unzulässigen Namensnennung betroffen sind, können rechtlich gegen die Veröffentlichung vorgehen. Ihnen steht ein Anonymitätsschutz zu.
Wenn Influencer sich indes gegenüber der Presse zu den Vorwürfen äußern, verfällt dieser Schutz. Pressestatement sollten daher unterbleiben.